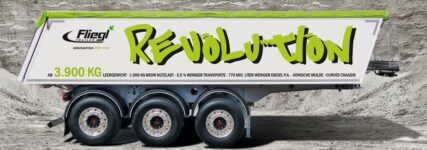Der 6×4-Elektro-Allrounder 40 R von Scania
Er wäre ein guter Start in den Elektro-Fuhrpark: Scanias 40 R als Dreiseitenkipper ist ein veritabler Alleskönner. Als Joker, als Zugfahrzeug und sogar als 44-t-Baustoff-Zug hat er das Zeug, die Transformation im Bau-Fuhrpark einzuläuten.

Die batterieelektrischen Bau-Lkw kommen jetzt Schlag auf Schlag. Volvo war der erste, der die Bedeutung der BET (batterieelektrischen Trucks) für die Bauwirtschaft erkannt hatte. Praktisch schon vor den Fernverkehrs-Sattelzugmaschinen, realisierten die Göteborger Truck-Bauer 4×2- und 6×2-E-Fahrgestelle für die verschiedensten Aufbauten. Denn die Nachfrage nach geräusch- und emissionsarmen Trucks für Einsätze in Städten war da, und Volvo reagierte mit leichten Zweiachs-Dreiseitenkippern, Absetzern und Abrollern. Später kamen sogar Vierachser mit Kran dazu, vorerst aber alle Versionen erst mal als Solo-Fahrzeuge. Für Renault war es da einfach bald nachzuziehen, trugen die ersten Renault-D- und D-Wide-Fahrgestelle doch den elektrischen Volvo-Antriebsstrang im Rahmen. Und auch Scania zog nach und war dabei sogar etwas schneller als die Schwestermarke MAN. Kurzum: Es ist höchste Zeit, dass die Straßenkipper und alles, was nicht täglich schweres Gelände beackert, elektrifiziert wird.
Anders als bei den Fernverkehrs-Trucks ist schiere Reichweite bei Bau-Lkw nicht das Thema. Vielmehr ist es die genaue Anpassung an den Einsatz, der hier Motorleistung und Batteriekapazität vorgibt. Denn es ist ja so: Selten absolvieren Straßenkipper mehr als 300 km während einer Schicht – in vielen Fällen ist es sogar deutlich weniger. Und wenn wir mal von einem groben Durchschnittsverbrauch von 80 bis 100 kWh/100 km ausgehen, dann reichen 300 kWh Kapazität für die meisten Einsätze aus, um ohne Zwischenladung über den Tag zu kommen.
Dieser Scania 40 R – das 40 steht für 400 kWh, das R fürs R-Fahrerhaus – ist so ein Kandidat, der im Baugeschäft als schneller Eingreifer im Solobetrieb unterwegs ist. Gelegentliche Ausflüge mit dem Tieflader und einem Bagger darauf wären ebenfalls ein veritabler Einsatz, als Schüttgut-Zug mit Tandemachs-Anhänger natürlich auch. Wir müssen uns hier mangels greifbarem Anhänger mit der Solo-Version begnügen. Aber: Auch deren Basis-Verbrauchswerte über unsere Nahverkehrs-Kipperrunde geben schon mal eine Hausnummer an, womit zu rechnen ist.

Denn es ist stets die erste Frage, egal wo wir mit dem 6×4-Dreiseitenkipper Pause machen, wie weit er denn kommt, und was er an Batterien denn dabei hat. Fragen, die sich leicht beantworten lassen: Links und rechts am Chassis ist je ein 200-kWh-Batteriepack angeschraubt, macht zusammen 400 (genau 416 kWh) Brutto-Kapazität. Weil Scania wie die meisten europäischen Hersteller auf NMC-Akkus (Nickel-Mangan-Cobalt) setzt, wird eine hohe Energiedichte mit einem relativ engen SOC-Level (SOC: State of Charge) erkauft, der hier bei nur 83 Prozent nutzbarer Energie vom Brutto-Wert liegt. Das wären dann immerhin noch 345 kWh, die uns aber locker über den Tag bringen sollten. Die Konzern-Schwester MAN verbaut im nagelneuen Nürnberger Akku-Werk ebenfalls NMC-Zellen, verspricht aber einen SOC-Level von 95 Prozent. Da schwingt also eine gewisse Vorsicht in Sachen Haltbarkeit bei der Scania-Lösung mit.
Die beiden Akku-Pakete hängen links und rechts zwischen der ersten und zweiten Achse am Rahmen. Nach unten sind sie durch relativ robust aussehende Alu-Paneele gegen Feindberührung geschützt. Die Halterungen fallen massiv aus, schließlich wiegt jedes dieser Akku-Packs rund 1,1 t, macht also schon mal 2,2 t für die Batterien aus. Ein wenig sonderbar erscheint auch die Verwendung von doppelt übersetzten AP-Achsen. Die haben zwar ein kleines Banjo für ordentlich Bodenfreiheit, für einen Straßenkipper hätte es eine einfach übersetzte Achse aber auch getan. Oder doch nicht? Wenn die angegebenen Übersetzungsverhältnisse stimmen, ergibt sich für diesen Truck eine Gesamtübersetzung von 1:12,8. Und das würde wiederum bedeuten, dass der E-Motor am Getriebe-Ausgang mit ungewöhnlich hoher Drehzahl herauskommt. Dann braucht es tatsächlich diese enorm kurze Achsübersetzung.
Wie auch immer: Wir beladen unseren Testkipper erst mal mit 12,3 t grobem Schotter, sodass wir bei 26,5 t Testgewicht (mit zwei Fahrern) auf der sicheren Seite sind. 27 t wären ja dank 1 t Bonus für den elektrischen 26-Tonner möglich. Mit Anhänger ist der 40 R gut für 44 t Gesamtgewicht, was auch seinem Leistungsangebot entspricht. Solo ist er natürlich komplett unterfordert.

Den Kindinger Berg rauschen wir – wie ein Strich – konstant mit 85 km/h hoch. Das ist fast schon langweilig, zeugt aber von E-Truck-typischer Stärke. Diskussionen übers Leistungsangebot erübrigen sich hier. Auf den Landstraßen-Stichen mit Steigungen um die zehn Prozent muss sogar der 40 R einen Gang zurückschalten. Von Drei auf Vier ist als kurze Zugkraftunterbrechung durchaus spürbar, wirkt sich aber auf die Performance am Berg kaum aus – kein Wunder bei 20 PS pro t Leistungsgewicht.
Entsprechend relaxed gestaltet sich das Fahren dieses Kippers an sich: Die Lenkung (Bosch) ist mit 4,5 Umdrehungen von hart links zu hart rechts ausgesprochen direkt, erfordert aber Aufmerksamkeit um die Mittellage herum. Da muss man sich dran gewöhnen. Die Federung ist straff. Zwar sitzt das Fahrerhaus auf vier Luftfederbälgen, was aber nichts über den Komfort aussagt. Schnelle Kurven meistert diese Aufhängung ohne Neigung, das gibt Sicherheit. Schlechte Wegpassagen leitet die robust mit drei Lagen Parabelfedern aufgehängte Vorderachse gut spürbar bis zum Fahrersitz durch. Das ist noch nicht unkommod und vermittelt jedenfalls Straßenfühligkeit. Etwas Besonderes ist auch die Aufhängung des Doppelachs-Aggregats. Beide Achsen sind an Lenker-ähnlichen Stahlfedern aufgehängt, am hinteren Ende federn jeweils zwei Luftbälge. Es gibt keine Stabis, von außen sucht man vergeblich nach den sonst üblichen Parabelfedern. Diese Aufhängung zeigt sich gleichwohl als überaus spurtreu und stabil.

Das Innere der halblangen und niedrigen R-Kabine dominiert das neue Armaturenbrett. Der Haupt-Cluster wirkt aufgeräumt und übersichtlich, die schräg stehenden Skalensäulen für Geschwindigkeit links und Last rechts sind mal was Neues: Während der Fahrer die große Digitalanzeige für die Geschwindigkeit wohl eher schätzt als diesen Hochkant stehenden Balkentacho, ist die Lastanzeige in Prozent eine gute Hilfe, um die tatsächlich gerade anliegende Belastung für den Triebstrang abzulesen. Unterhalb der Nullposition zeigt der Balken zurückgewonnene Energie beim Bremsen. Fast noch besser ist, dass sich der zur Pflicht gewordene Alarm für vom System festgestellte Geschwindigkeits-Überschreitungen mit einem Tastendruck abstellen lässt. Bei manchen Konkurrenten muss man dafür jedes Mal nach „Zündung Aus” mit mehreren Tastendrücken ins Einstellmenü eintauchen.
So eine Direkt-Taste wünscht sich vermutlich so mancher, wenn er seinen Nebenabtrieb aktivieren möchte. Den gibt’s hier nicht. Stattdessen ist auf dem Sekundärbildschirm ein eigenes Menü aufzurufen, der Nebenabtrieb taucht dann als Schaltfeld auf dem Touchscreen auf. Ob das so zielführend ist sei mal dahingestellt. Offenbar erfordert die Elektronik-Architektur des Antriebs diesen Software-Schalter.
Zum Abkippen setzt sich das Chassis wie üblich automatisch auf die Achsen, dann hängen die Batteriekästen schon sehr nah am Boden. Aber auch bei eingestelltem Fahrniveau schränken die Batterien die Bodenfreiheit ein. Ausflüge in tiefen Boden verbieten sich da.
Was verbraucht so ein E-Kipper also voll ausgeladen: Den Autobahnbetrieb mit 84 km/h Marschgeschwindigkeit quittiert der Scania 40 R im Schnitt mit rund 100 kWh/100 Kilometer. Auf der Landstraße begnügt er sich mit 94 kWh/100 km, über die Gesamtrunde sind es alles in allem 101 kWh/100 km. Ob das viel oder wenig ist: schwer zu sagen. Ein Renault 6×2 mit Abrollkipper und 21,5 t Testgewicht konsumierte über die gesamte Runde gut 90 kWh/100 km. Ein Volvo FH Aero Electric mit Abroll-Behältern als Fracht und 42 t Testgewicht liegt bei 165 kWh/100 km. Fakt ist: In Sachen Effizienz ist der elektrisch angetriebene 6×4-Kipper im Vergleich zu seinem Diesel-Pendant nicht zu schlagen. Der verbraucht in der Regel doppelt so viel Energie unter gleichen Bedingungen.
Womit wir wieder bei der Reichweite wären. Unser Testkandidat käme also gut über 300 km weit mit einer Batterieladung. Da Kipper die Hälfte des Wegs meist leer zurücklegen, dürfte die Reichweite deutlich höher liegen. Damit käme man mit einer Depot-Ladelösung auf dem heimischen Hof gut über die Runden. Und da müsste noch nicht mal ein 400-kW-Power-Charger installiert sein. Über Nacht würde weit weniger Ladeleistung vollkommen ausreichen. Unterwegs und dazwischen zu laden, wäre in einer 45-Minuten-Pause auch kein Thema: Der 40 R verträgt bis zu 375 kW DC-Ladeleistung, da bringt die Pause um die 300 kWh und verdoppelt somit die Reichweite in noch nicht mal einer Stunde Ladezeit.