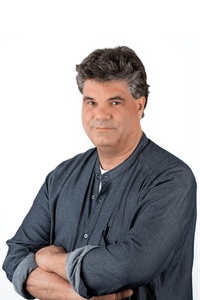Retro-Serie Teil IV: Globalisierung und Bauboom Ost in den 1990er-Jahren
Die 1990er-Jahre standen für politische Neuordnung und riesige Bauaufgaben im Zuge der Wiedervereinigung. Gleichzeitig brachte die Globalisierung bislang unbekannte Anbieter von Baumaschinen ins Spiel.

Die deutsche Bauwirtschaft startete mit guten Vorzeichen ins neue Jahrzehnt, und der Fall der Mauer im Jahr 1989 hatte zusätzliche Perspektiven eröffnet. Als nach der Wiedervereinigung im Herbst 1990 auch noch beschlossen wurde, den Regierungssitz von Bonn nach Berlin zu verlagern, löste dies eine Bautätigkeit bislang nicht gekannten Ausmaßes in der neuen Bundeshauptstadt aus.
Die Baubranche hatte in den anspruchsvollen 1980er-Jahren recht empfindliche Anpassungen der Kapazitäten vorgenommen – sollte man diese nun wieder aufbauen? Den Fachleuten war klar, dass diese Hochphase nicht ewig anhalten würde, was sich dann auch bereits ab Mitte der 1990er-Jahre bewahrheitete. Unterm Strich fiel die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe in diesem Jahrzehnt von 1,4 Millionen auf eine Million. Zugleich begann sich die Struktur der Bauunternehmungen nachhaltig zu verändern. Hatten die großen Baukonzerne bisher einzelne Fachabteilungen für nahezu jedes Gewerk vorgehalten, wurden deren Aufgaben zunehmend an Nach-Unternehmer vergeben. So sollten Kosten gesenkt und gleichzeitig die Flexibilität erhöht werden. Unschöne Nebeneffekte waren jedoch, dass gleichzeitig Know-how und handwerkliche Ausbildungsplätze verloren gingen und unternehmerisches Risiko auf finanziell schwächere Schultern verlagert wurde.

Die bestens etablierte Bauma fand 1995 zum letzten Mal auf der Theresienwiese statt und war 1998 die erste Veranstaltung auf dem neuen Messegelände in München-Riem, das auf dem ehemaligen Flughafengelände entstanden war. Der Start war zwar wegen der noch fehlenden U-Bahn-Anbindung noch etwas holprig, jedoch war der Grundstein für die heutige Mega-Veranstaltung gelegt.
Was im Rückblick als die Anfänge von Digitalisierung und Vernetzung wahrgenommen wird, galt in den 1990er-Jahren allenfalls als technische Spielerei. Das Internet schien etwas für Computer-Nerds zu sein, und der Einsatz von Mobiltelefonen war allenfalls in geschäftlichen Zusammenhängen zu rechtfertigen – es sei denn, man wollte als Wichtigtuer wahrgenommen werden.
Der Aufbau Ost
In den neuen Bundesländern machte sich nach der Wiedervereinigung eine regelrechte Goldgräberstimmung breit. Und bekanntlich hat ja auch am Yukon nicht zwingend derjenige den größten Reibach gemacht, der den größten Nugget ausbuddelte, sondern vielmehr der, welcher als Erster vor Ort war, um den Glücksrittern Schaufeln und Hacken zu verkaufen. Die Baumaschinenhersteller beziehungsweise deren Händler waren also alsbald damit beschäftigt, das neue Gebiet aktiv zu erschließen. Auch bei manchem Gebrauchtmaschinen-Händler setzte hektische Betriebsamkeit ein: Es galt, langjährige Ladenhüter optisch aufzuhübschen und die Preislisten der großen Nachfrage anzupassen. Es darf davon ausgegangen werden, dass sich die Kaufberatung nicht ausschließlich am tatsächlichen Bedarf der Kunden orientierte. Neben solch fragwürdigen Geschäftspraktiken gab es natürlich auch Konzepte, die auf nachhaltige Kundenbindung angelegt waren.
Auf der Anwenderseite wurden staatliche Bauunternehmungen privatisiert oder mit großem Elan neu gegründet. Auch eröffneten zahlreiche westdeutsche Baufirmen in aller Eile Niederlassungen im Osten: Zu verlockend war die Aussicht auf eine Teilhabe am großen Bauboom. Als die erste Euphorie verebbt war, zeigte sich, wessen Engagement auf Dauerhaftigkeit angelegt war – und so mancher konzentrierte seine Aktivitäten bald wieder auf das Heimatrevier.

Auch in der DDR hatte es, weitgehend unbemerkt vom Westen, eine ernstzunehmende Baumaschinen-Produktion gegeben. Ehemals volkseigene Betriebe wurden jetzt privatisiert oder es wurden erstmalig Baumaschinen ins Produktionsprogramm aufgenommen. Bei Nobas in Nordhausen wurden Seil- und Hydraulikbagger gebaut, das Weimarwerk entwickelte neue Mobilbagger, bei der Wismut wurden Radlader gefertigt und die Mechanischen Werkstätten Königswartha produzierten erstmals einen Minibagger.
Neue Player und ein runder Look
Bestimmte Muster wiederholen sich ja immer wieder. Die Schleife aus Nichtbeachtung, Kleinreden und schließlich Ruf nach Regulierung hatten in den 1980er-Jahren ja bereits die japanischen Hersteller durchlaufen – jetzt waren die Koreaner dran. Auf der Bauma 1992 traten in der Branche bisher weitgehend unbekannte Marken vergleichsweise selbstbewusst auf. Namen wie Samsung, Daewoo oder Hyundai waren allenfalls aus der Elektronikbranche bekannt beziehungsweise als Pkw-Hersteller in Erscheinung getreten – wer aber kannte Halla?
Die koreanischen Anbieter hatten auch registriert, wie japanische Unternehmen mit EU-Strafzöllen belegt worden waren, und gründeten deshalb sehr früh eigene Fertigungsstätten in Europa. Daewoo montierte Maschinen im Frameries und Hyundai in Geel, beides in Belgien gelegen. Bei Samsung unterhielt man für kurze Zeit ein Werk in UK, bis sich die Thematik elegant auflöste, als die Baumaschinensparte 1998 komplett von Volvo übernommen wurde. Die koreanischen Maschinen basierten anfänglich auf Lizenzen hauptsächlich japanischer Produkte, dadurch waren sie technisch und optisch den aktuellen Modellen etwas hinterher – was sich jedoch bald ändern sollte. Zugegebenermaßen entsprachen die frühen Koreaner noch nicht so recht den hiesigen Gewohnheiten, was die Charakteristik der Steuerung und die Ausrüstung betraf. Jedoch fanden die Wünsche der europäischen Anwender durch das wachsende Händlernetz zunehmend Gehör in den koreanischen Konstruktionsabteilungen. Die Koreaner waren also gekommen um zu bleiben und konnten schrittweise das Image des Billiganbieters abstreifen.

Auch die japanischen Anbieter blieben natürlich nicht untätig. Die bislang wenig bekannte Marke Furukawa hatte 1989 das Dresser-Werk in Heidelberg übernommen, dort waren zuvor die bekannten IHC-Payloader gebaut worden. Man versprach sich davon eine günstige Ausgangsposition im europäischen Wettbewerb. Die Entwicklung lief jedoch nicht so erfolgreich wie erhofft, und so legte man bereits 1993 die Produktion wieder still und verlagerte die Fertigung ins ebenfalls zum Konzern gehörende, ehemalige Yumbo-Werk nach Frankreich. Obwohl die Maschinen einen recht guten Ruf genossen, zog sich Furukawa 2002 endgültig aus diesem Marktsegment zurück.
Ein weiterer Trend war beim Design der Baumaschinen zu beobachten: Alles musste in den 1990er-Jahren rund werden, wollte es modern wirken. Ob es sich um eine Würdigung der Formensprache der 1950er handeln sollte oder ob es einfach nur eine Abkehr von den klaren Linien der 1980er-Jahre war, konnte nie gänzlich geklärt werden. Einmal abgesehen vom persönlichen Geschmack, entstanden durch diese Art der Gestaltung viele Verkleidungs- und Glas-Elemente, die in mehreren Richtungen gewölbt waren. Damit wurde die Herstellung aufwendiger und kostspieliger, was sich auf die Ersatzteilpreise auswirkte. Letzteres dürfte für einigen Unmut bei den Anwendern gesorgt haben, was die Hersteller schließlich zum Umdenken bewegte, und viele Nachfolgemodelle machten wieder einen deutlich sachlicheren Eindruck.
Weltrekord und neue Hausherren
Im Wettbewerb, wer den größten Hydraulikbagger baut, war es zuletzt etwas ruhiger geworden. Vorhandene Modelle wurden bezüglich Dienstgewicht und Schaufelinhalt noch weiter ausgereizt, jedoch war ein richtiger Paukenschlag ausgeblieben – bis zum Sommer 1997. Da nämlich wurde im O&K-Werk in Dortmund-Dorstfeld der RH 400 vorgestellt. Mit 800 t Dienstgewicht und einem Schaufelinhalt von 40 m³ war er der größte Hydraulikbagger der Welt. Da er im Laufe der Jahre noch diverse Upgrades erhielt, gilt dies übrigens bis heute.
Nachdem die Hoesch AG, zu der auch O&K gehörte, 1992 vom Krupp-Konzern (feindlich!) übernommen worden war, versuchten die neuen Eigentümer, die selbst in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten, die Geschäfte neu zuordnen. An der Herstellung von Baumaschinen hatte man offenkundig kein Interesse, und so wurde die einst breit aufgestellte Firma Orenstein & Koppel stückweise vermarktet. Im Frühjahr 1998 wurde die profitabel arbeitende Mining-Sparte an Terex verkauft, wenig später das defizitäre Baumaschinengeschäft an New Holland. Damit war das Ende einer großen Maschinenbautradition mehr oder weniger besiegelt.

Auch anderswo standen größere Maßnahmen zur Umstrukturierung ins Haus. Die große Zeit der Stahl- und Maschinenbaukonzerne, die das deutsche Wirtschaftswunder geprägt hatten, schien langsam aber sicher zu Ende zu gehen. Beim Düsseldorfer Mannesmann-Konzern hatte man die Lust am Maschinenbau gänzlich verloren und suchte sein Heil nun im Mobilfunk. Hatte man die Demag AG in den 1970er-Jahren selbst noch feindlich übernommen, stand sie nun bereits wieder zur Disposition. In diesem Zuge schloss die Baumaschinen-Abteilung 1996 zunächst ein Joint-Venture mit Komatsu, woraus 1999 die Komatsu Mining Germany GmbH wurde. Manche bedauerten damals den Verlust eines traditionsreichen Namens. Im Nachhinein muss der Schritt als Erfolg gewertet werden, denn der Standort existiert bis heute, wohin gegen der Mannesmann-Konzern lange Geschichte ist.
Der Name Komatsu tauchte auch in Zusammenhang mit einem weiteren bekannten deutschen Baumaschinenhersteller auf. Die Hanomag in Hannover hatte sich in den 1980er-Jahren von den ärgsten Turbulenzen erholt. Trotzdem brauchte es einen größeren Partner, um am internationalen Markt langfristig bestehen zu können. Nachdem sich die Japaner bereits 1989 an dem Unternehmen beteiligt hatten, wurde 1995 schließlich Komatsu-Hanomag gegründet. Auch dieser Standort existiert bis zum heutigen Tage.
Neue Technologien und Geschäftsmodelle
Dass sich noch eine komplett neue Maschinengattung am Markt etablieren kann wurde immer unwahrscheinlicher. So konzentrierten die Maschinenhersteller ihre Ressourcen in Forschung und Entwicklung auf die Optimierung der vorhandenen Modelle. Hydrauliksysteme boten noch Potential zur Verbesserung, auch Lärmreduktion war weiterhin ein Thema, und der Fahrerkomfort wurde erstmals auf ein Niveau gehoben, das mit der Erfahrung in einem Pkw vergleichbar war. Die Elektronik eröffnete neue Möglichkeiten zur Darstellung von Betriebszuständen in der Kabine und zum Auslesen von Fehlern durch das Service-Personal. Mit Rotationslasern und integrierten Empfängern auf Gradern und Raupen konnten erstmals frühe Formen der Maschinensteuerung realisiert werden. Damit konnten systembedingt zwar nur ebene Flächen angelegt werden, jedoch war dies schon eine große Hilfe zur Erhöhung der Genauigkeit bei gleichzeitig geringerem Zeitaufwand.
Zwei Entwicklungen, die sich gegenseitig bedingten, waren die wachsende Vielfalt an Anbaugeräten und die größere hydraulische Leistungsfähigkeit der Baumaschinen. Hatte das Werkzeug-Repertoire eines Hydraulikbaggers einst aus diversen Tieflöffeln, einem Zweischalengreifer und vielleicht noch einen Hydraulikhammer bestanden, kamen in den 1990er-Jahren Anbaugeräte für vielfältige Aufgaben auf den Markt. Besonders schnell wuchs das Angebot der Abbruchwerkzeuge, und auch für den Erd- und Spezialtiefbau blieben kaum noch Wünsche offen. Die vielfältigen Möglichkeiten verlangten naturgemäß auch nach höherer Flexibilität der Trägergeräte, ohne ein Schnellwechselsystem wären sie kaum wirtschaftlich nutzbar gewesen. So machten sich diverse Anbieter daran, ein eigenes Kupplungssystem zu entwickeln. Es wurde leidenschaftlich über Aufbauhöhe, Zusatzgewicht, Spielfreiheit und Bedienerfreundlichkeit diskutiert. Letztlich konnte sich allerdings nur eine Handvoll Systeme durchsetzen. Wer auf ein eher exotisches System gesetzt hatte stand irgendwann vor der Wahl, dies weiter durchzuhalten oder kostenintensiv auf einen der Marktführer umzustellen.
Auch der Baumaschinenhandel entwickelte neue Geschäftsmodelle. Bislang war es gängige Praxis, dass ein Bauunternehmer eine Maschine käuflich zu erwerben hatte, wenn er damit arbeiten wollte. Dadurch wurde eine Menge Kapital gebunden und es war nicht immer gewährleistet, dass man für das jeweilige Gerät auch eine passende Anschluss-Arbeit finden würde. Die Idee der Vermietung von Baumaschinen hatte sich jedoch bislang nicht so recht durchsetzen können. Meist wurden nur Kleingeräte angeboten oder es wurde allenfalls mal eine Maschine vom Hersteller gemietet, um einen Ausfall oder die Lieferzeit einer Neuanschaffung zu überbrücken. Unter anderem war es der neue Markt in Ostdeutschland, der Bewegung in die Sache brachte. Es entstanden diverse Unternehmen mit dem Hauptgeschäftsfeld der Baumaschinen-Vermietung. Firmen wie MVS, heute Zeppelin Rental, oder HKL eröffneten stetig neue Standorte und bauten große Flotten von Mietmaschinen unterschiedlichster Art auf.
Auf einmal war es möglich, bestimmte Geräte, die im eigenen Bauunternehmen nicht vorgehalten wurden, projektbezogen anzumieten. Gleichwohl mussten die Anbieter zunächst einmal die Erfordernisse des Marktes ausloten – und nahmen teils auch kostspielige Sondermaschinen wie Straßenfertiger, Brecheranlagen oder Teleskop-Mobilkrane in ihr Angebot auf. Es gab Mietkataloge, die den Umfang eines Großstadt-Telefonbuchs erreichten. Mit dieser Vielfalt war dann doch die Mehrheit der Anwender überfordert, und auch die Auslastung ließ dementsprechend zu wünschen übrig. Das Prinzip der Baumaschinenmiete hatte sich jedoch nachhaltig etabliert, und bei den Anbietern kristallisierte sich zunehmend ein Portfolio heraus, das den Ansprüchen der Kunden entsprach.
Unser Fazit
Die 1990er-Jahre waren geprägt von großen politischen Umbrüchen. Die Wiedervereinigung bescherte der Baubranche eine vorübergehende Boomphase, die sich zum Ende des Jahrzehnts bereits wieder deutlich abgekühlt hatte. Das Angebot an Baumaschinen wurde noch einmal deutlich internationaler, durchaus zum Missfallen der einheimischen Hersteller. Die Globalisierung war jedoch Fakt, und was aus dem asiatischen Markt nach Europa gelangte, war aus heutiger Sicht lediglich der Vorgeschmack. Und auch wenn der online vernetzte Bagger, der teilautonom ein 3D-Geländemodell abarbeitet, noch in weiter Ferne lag: Die Grundlagen dafür waren gelegt.